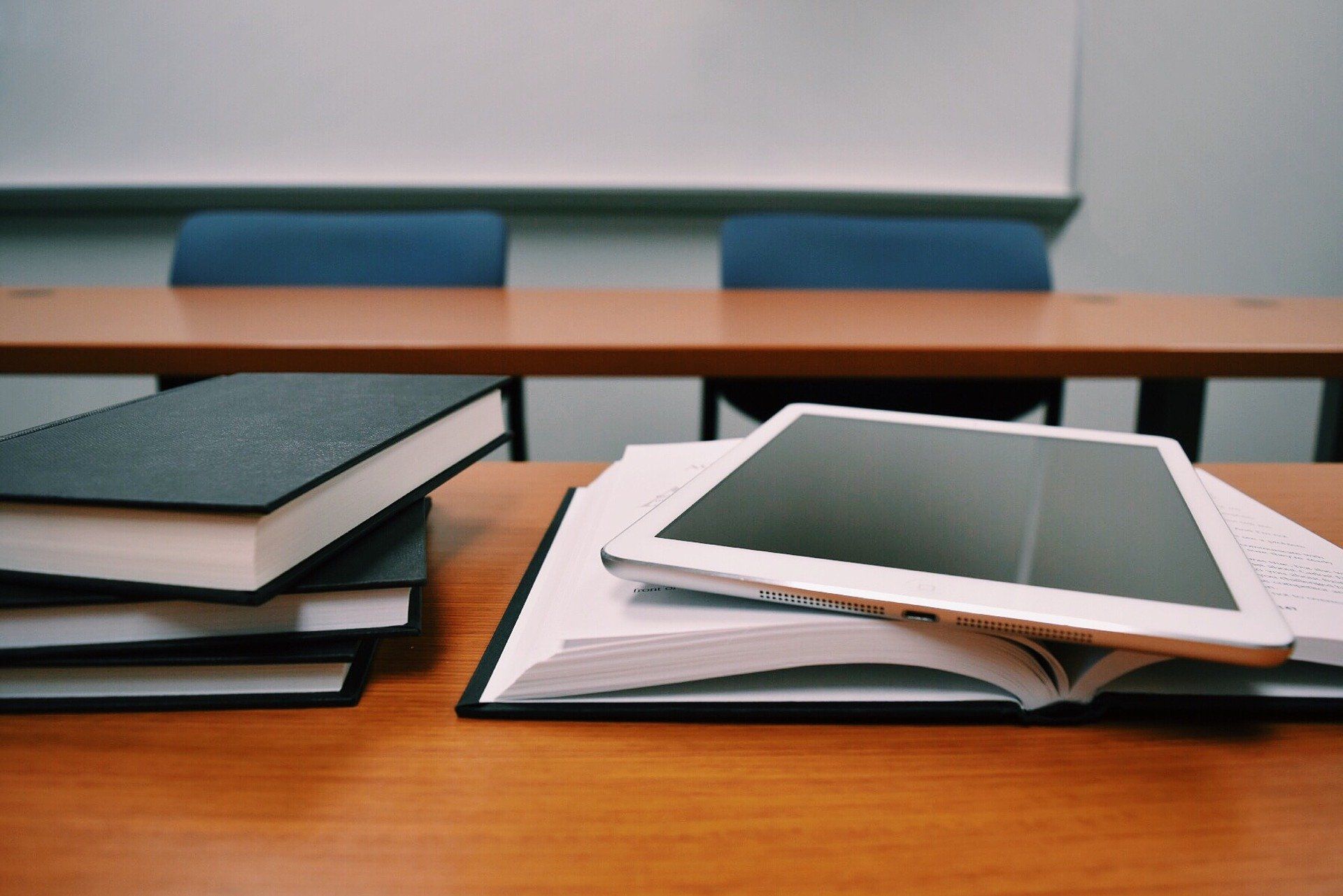Brennpunkt 2
Der Parteienstaat
dem Volk im Namen des Volkes
feierlich das Fell über die Ohren zu ziehen"
Karlheinz Deschner
2.1 Parteienstaat oben - Volk unten
Demokratie - ein Begriff, der im antiken Griechenland entsteht - heißt übersetzt eigentlich Herrschaft des Volkes. Unserem Grundgesetz (GG) zufolge leben wir alle in einer "freiheitlich demokratischen Grundordnung". Aber dieser hehre Begriff "Demokratie" wird, beginnend mit dem Parlamentarischen Rat und danach zur Worthülse, zu einer, durch die Parteien repräsentierten Demokratie oder treffender, zum Parteienstaat.
Theodor Heuss. Unser erster Bundespräsident war ja einer der maßgeblich Mitwirkenden beim Zustandekommen unseres Grundgesetzes. Er war es, der vom demokratischen Mitwirken des Volkes in der werdenden Bundesrepublik eindrücklich gewarnt hatte. Solche basisdemokratischen Bürgerrechte wie beispielsweise in der Schweiz seien eine „Prämie für jeden Demagogen“. Hatte er verdrängt, dass er 1933 als damaliger Reichstagsabgeordneter dem berühmt berüchtigten vom frisch gebackenen Reichskanzler Adolf Hitler eingebrachten „Ermächtigungsgesetz“ zugestimmt hat? Er hätte zumindest spüren müssen, um welches Einfallstor in die Diktatur es sich dabei handelte.
Art. 21 Abs. 1 GG lautet:
"Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit".
Die Praxis ist eher umgekehrt: Das Volk wirkt bei der politischen Willensbildung der Parteien mit. Und wie sieht unsere "Mitwirkung" aus? Bei Bundes- und Landtagswahlen dürfen wir alle vier bis fünf Jahre derjenigen Partei unsere Stimme durch Ankreuzen auf dem Wahlvordruck geben, die wir für die beste halten. Dabei ist es nicht so wie in den Restaurants, wo Sie in der Speisekarte eines der angebotenen Gerichte auswählen können. Mitnichten: Je Partei wird uns gerade mal ein Kandidat genannt, der zudem in den Parteihierachien vorbestimmt ist. Damit verletzt der Parteienstaat Art. 38 Abs. 1. Satz 1 GG, wonach den Bürgern die freie Wahl zusteht. Woher haben Parteien das Recht, den ihrer Meinung nach geeignetsten Repräsentanten aus mehreren Benannten auswählen zu können?
Ist all dies für Sie noch politische Willensbildung?
Wie Wahlfreiheit verfassungskonform vonstattengeht, das zeigen uns die Kommunalwahlen. Dort stehen uns - wie bei den Speisekarten der Restaurants - je Partei eine Menge zu wählender Kandidaten zur Auswahl. Durch sogenanntes Kumulieren und Panaschieren können Sie zudem einem oder mehreren Aspiranten bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren) sowie Ihre Wunschkandidaten aus verschiedenen Parteien auswählen (panaschieren). Aber nicht nur Parteien, sondern auch parteilose Wählergemeinschaften dürfen zu den Kommunalwahlen antreten und sich wählen lassen.
Warum dieses bürgernahe Wahlverfahren nicht auch bei den Land- und Bundestagswahlen oder sehen Sie das anders?
Für uns eher noch gewichtiger ist die Negierung von Art. 20 Abs. 2 unseres Grundgesetzes durch den Parteienstaat.
"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt".
Für Abstimmungen, beispielsweise durch Volksbegehren mit Volksentscheid, besteht auf Bundesebene keine rechtliche Basis. Die "Bürgerinitiative Demokratie entwickeln" war damit auf Kommunal- und teilweise auch auf Landesebene mit großem Durchhaltevermögen bereits erfolgreich, jedoch nicht auf Bundesebene. Warum bloß, wo Volksabstimmungen beispielsweise in der Schweiz seit langem gang und gäbe sind?
Ja, was sagen Sie zu dieser bürgerfernen Grundstimmung unserer Parteien?
Art. 20 Abs. 2 GG normiert auch das Prinzip der Gewaltenteilung. Gesetzgebung, vollziehende Gewalt sowie Rechtsprechung müssen von "besonderen", also voneinander getrennten "Organen ausgeübt" werden. Dies deshalb, weil nur so Gewaltenteilung zu erreichen ist. Das Prinzip der Gewaltenteilung wurde bereits von Montesquieu noch vor der französischen Revolution als Schlüssel hin zu einer Konstitutionellen Monarchie entdeckt. Später dann galt es, den proklamierten Demokratien oder Republiken als tragendes Fundament.
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG ist der Gewaltenteilung zu dienen bestimmt und lautet wie folgt:
"Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages … sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen."
Innerhalb der Parteien herrscht stattdessen "Fraktionszwang". So wird die Parlamentsmehrheit zum sicheren Polster der Regierung. Damit ist die Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und vollziehender Gewalt schon mal sehr brüchig.
Und die Gewaltenteilung im Verhältnis Parteien und Rechtsprechung?
Art. 94 Abs. 1 GG bestimmt folgendes:
"Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen des Landes angehören."
Wiederum haben die Parteien das Wort. Nach alt bewährtem Proporzdenken beerben sie zumeist verdiente Parteiangehörige mit diesen hohen Ämtern; selbstredend solche, die sie für geeignet halten. So steigt beispielsweise der vormalige bayrische Innenminister Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier zum Präsidenten des BVerfG´s auf. Ja, auch hier nicht Willensbildung des Volkes, sondern solche des Parteienstaats.
Und trotz allem geschieht Unerwartetes. Das BVerfG wird von uns Bürgern zumeist als Hüter unserer Bürgerrechte, auch gegen Herrschaftsambitionen des Parteienstaates zurecht geschätzt. Interessant: bereits 1961 pocht das BVerfG im sogenannten Ersten-Fernseh-Urteil auf die "Freiheit von staatlicher Beherrschung der Einflussnahme" und begründet dies mit Art. 5 Abs. 1 GG. Recht der freien Meinungsäußerung - in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 GG - Grundrechtsbindung - als unmittelbar geltendes Recht. Diese Entscheidung durchkreuzt Bundeskanzler Adenauers Absicht, einen Fernsehsender unter seinen Fittichen ins Leben zu rufen. Die Verfassungsrichter sind mutig, denn sie wurden vom Parteienstaat als solche ernannt. Zugleich bekräftigen sie damit das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung.
Sehen Sie auch dieses Licht am Ende des Tunnels unseres Parteienstaats?
2.2 Herrschaftspatronage
Bereits vor einem halben Jahrhundert prägt diesen Begriff der Staatsrechtler und Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg aus der Uni Tübingen im Hinblick auf den Parteienstaat. Dazu ein passendes, leicht erheiterndes Rätsel
In einem Bewerbungsverfahren zur Besetzung einer Dienststelle werden die drei Interessenten nach dem Produkt aus 2.5 mal 2.5 gefragt. Der erste meint 6, der zweite 7, der dritte 6,25. Raten Sie mal, wer die begehrte Stelle zugeteilt bekommt, der mit 6, mit 7 oder 6,25? …
Richtig! der mit dem richtigen Parteienbuch.
Nichts schildert so kurz und bündig das Innenleben des Parteienstaates. Dazu wiederum Theodor Eschenburg griffig:
"Wer befördert befiehlt"
In der gesamten öffentlichen Verwaltung mit ihrem mehrstufigen Hierarchie-Prinzip sowie den Politikern an der Spitze ist solches routinierte Perfektion.
Weil´s so anschaulich ist, ein Beispiel, passend zum Gegenstand der Bürgerbewegung: der Schulherrschaft des Parteienstaates:
Eine vakant gewordene Schulleiterstelle wird ausgeschrieben. Welcher Bewerber soll nun den Zuschlag erhalten? Das zuständige Oberschulamt begründet gegenüber dem Kultusministerium den Bewerber A wegen seiner besonderen fachlichen Qualifikation. Ein Landtagsabgeordneter und Parteifreund des Kultusministers hat von der Angelegenheit "Wind" bekommen". Er rät dem Minister, sich nicht für A sondern für B zu entscheiden, denn B sei ebenfalls Mitglied der eigenen Partei, nicht jedoch A. Prompt entscheidet sich der Minister für B.
Dazu passt gar trefflich ein Beispiel einer verwaltungsinternen Hochrechnung, mit dem Ergebnis, dass von 17 Schulleitern 16 der Regierungspartei angehören.
Herrschaftspatronage. Seit Staatsschulgründung im Königreich Preußen als Antwort auf die Französische Revolution ein bewährtes Vehikel, die Schüler*innen zu "staatstreuen, gehorsamen Bürgern" zu erziehen. Kurz und bündig: im Bereich Schulwesen mutiert die einstmals König-Kaiserliche Monarchie zur parteienstaatlichen Oligarchie.
2.3 Politisches Kartell
"Cliquen, Klüngel und Karrieren -
über den Verfall der politischen Parteien."
Eine Studie von Erwin und Ute Scheuch
1954 ist auch der damalige Bundesfinanzminister Schäffer für eine sogenannte Aufwandsentschädigung für die im Bundestag vertretenen Parteien zu haben. Die Abgeordneten sollen in ihrer Arbeit frei und von niemandem abhängig sein, insbesondere nicht von wirtschaftlichen Interessen. Zur Verdeutlichung dieser Autonomie soll den Parteien die Annahme von Spenden insbesondere der gewerblichen Wirtschaft gesetzlich untersagt werden.
Ein paar Jahre später sieht die Welt schon etwas anders aus. Erpicht auf zunehmend mehr Staatssubventionen steht den Parteien der Gesetzesvorbehalt im Wege. Aber zu was das ganze Theater mit drei Bundestagslesungen und Abstimmungen, wo alle Parteien ohnehin einer Meinung sind? Und warum dabei auch noch schlafende Hunde wecken? "Parteien betreiben wieder mal Honorarerhöhung." und dergleichen mehr. Aber Not macht erfinderisch. Warum die Höhe der Aufwandsentschädigung nicht einfach aus dem Parteienrecht rüber in den Jahreshaushalt verpflanzen und sie in der dortigen Postenfülle verstecken? Auch wenn über die Verwendung der Steuermittel im Bundestag kontrovers debattiert wird, das Kapitel Parteienfinanzierung bleibt "sprachlos."
Die Problemstellungen werden zunehmend komplexer, hinzu kommt die immer gewichtiger werdende Lobbypflege. Schließlich ist es die produzierende Wirtschaft, die Arbeitsplätze samt Einkommen unters Volk bringt sowie den Staatshaushalt kräftig unterfüttert. Wirtschaft also als Motor für den wachsenden Geldumlauf. Ja, aus den einstmals ehrenamtlichen Abgeordneten wird über all die Jahre ein vollgepumpter Fulltimejob samt Mitarbeiterstab. Damit wird die "Entscheidung des Parlaments in eigener Sache" - so das Bundesverfassungsgericht - immer wichtiger. Für den Politikwissenschaftler Otto Kirchheimer bilden die Parteien somit zusammen ein "Politisches Kartell".
Wie sehen Sie das alles? Wieder sind wir gespannt auf Ihre Antworten.
Wenn Sie mehr davon wissen wollen, so empfehlen wir Ihnen "Die Hebel der Macht und wer sie bedient - Parteienherrschaft statt Volkssouveränität" von Hans Herbert von Arnim, 2017 im Wilhelm Heyne Verlag erschienen.