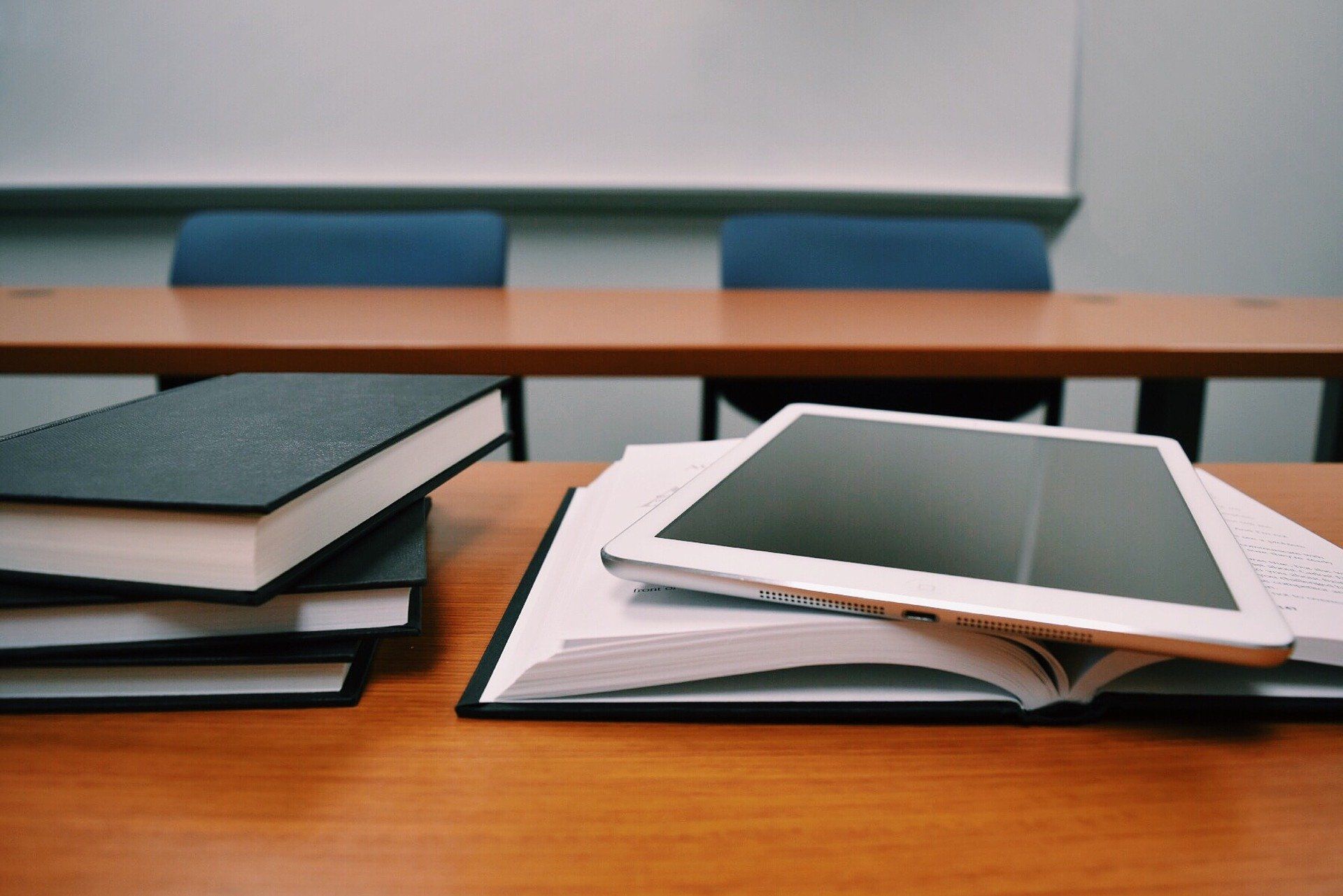Brennpunkt 6
Brennpunkt 6
Subsidarität für basisdemokratisches Handeln
"Wer anders denkt als seine Zeit,
muss nicht von gestern sein,
wer denkt, wie sie, ist es"
Karlheinz Deschner
"Small ist beautiful - Die Rückkehr zum menschlichen Maß". So der Titel eines Buches des insbesondere im anglo-amerikanischen Kulturkreis als Wirtschaftsexperte bekannten Ernst Friedrich Schumacher.
Ja richtig! Er floh aus Bonn 1937 nach Groß-Britannien. "Fritz" sieht in einer vielgestaltigen Wirtschaft die maximalen Entwicklungschancen. Eigeninitiative, Flexibilität, Selbstverantwortung und Kooperation ergeben zusammen Energie und Motor für die mannigfaltigen ökonomischen Bewegungen. "Fritz" veranschaulicht damit subsidiäres Denken. Jetzt einige Zitate aus seinem Buch:
„Vielen dieser kleinen Einheiten geht es sehr gut, und sie liefern der Gesellschaft die meisten der wirklich fruchtbaren neuen Entwicklungen. Auch hier ist die Theorie nicht leicht mit der Praxis zu vereinbaren...
Während viele Theoretiker... die Größe verherrlichen, gibt es bei realistisch denkenden Menschen im täglichen Leben ein starkes Verlangen und ein Streben danach, die Vorteile der Kleinheit zu nutzen, wo immer das möglich ist: Annehmlichkeit, Menschlichkeit und Überschaubarkeit. Auch diese Neigung kann jeder Mensch mühelos an sich selbst feststellen.
... Wir brauchen immer zugleich Freiheit und Ordnung. Wir brauchen die Freiheit sehr vieler kleiner unabhängiger Einheiten und zugleich das Ordnungssystem einer großen Einheit. Wenn es darum geht, zu handeln, sind offenbar kleine Einheiten erforderlich, weil das Handeln stark auf die Person bezogen ist und man nicht mit mehr als einer sehr begrenzten Anzahl von Menschen zusammen sein kann.
Je aktiver und je mehr wir auf den einzelnen Menschen uns beziehen können, desto größer ist die Zahl der Beziehungen. Nehmen wir den Unterricht als Beispiel. Die Frage der Größe ist heute äußerst wichtig. Jedoch, die wirklichen Dinge des Lebens lassen sich nicht berechnen.“ Wenn sich die westliche Kultur in einem Zustand fortdauernder Krisen befindet, ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass mit der Bildung etwas nicht in Ordnung ist."
Auch die katholische Kirche spricht sich in Enzykliken schon lange zur sozialen Seite unserer Lebensgemeinschaft aus. In solchem Sinne äußerte sich Papst Pius XI. 1931 in der „Quadragesimo anno“ erst-malig und in die Zukunft blickend zur Subsidiarität. Sie ist die wohlbegründete, weitsichtige Anschauung gegen zentralistische obrigkeitliche Bestrebungen des Staates. Sie will dem Staat nur die helfende Ergänzung der Selbstverantwortung kleiner Gemeinschaften zu-gestehen, z. B. mit finanziellen oder wirtschaftlichen Zuwendungen. Damit ist Subsidiarität Kerngedanke für ein freilassendes, entwicklungsfähiges Miteinander menschlicher Gemeinschaften. Sie konkretisiert die großartigen Errungenschaften um die Französische Revolution (1789 - 1795) herum. Insbesondere die Erklärung von unveräußerlichen Menschenrechten. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Solidarität) sind ja elementarer Bestandteil der Evolution und allen Menschen inhärent. Die aktuelle Formulierung des Prinzips der Subsidiarität hat folgenden Wortlaut:
„Funktionsstörungen und Mängel im Wohlfahrtsstaat rühren von einem unzutreffenden Verständnis der Aufgaben des Staates her. Auf diesem Gebiet muss das Subsidiaritätsprinzip beachtet werden: Eine übergeordnete Gesellschaft darf nicht in das innere Leben einer untergeordneten Gesellschaft dadurch eingreifen, dass sie diese ihrer Kompetenzen beraubt. Sie soll sie bei Bedarf unterstützen und ihr dazu helfen, ihr eigenes Handeln mit der dem der anderen gesellschaftlichen Kräfte im Hinblick auf das Gemeinwohl abzustimmen.
Der Versorgungsstaat, der direkt eingreift und die Gesellschaft ihrer Verantwortung beraubt, löst den Verlust an menschlicher Energie und das Aufblähen der Staatsapparate aus, die mehr von bürokratischer Logik, als von dem Bemühen beherrscht werden, den Empfängern zu dienen; Hand in Hand damit ergeht eine ungeheure Aufgabensteigerung - Man sollte annehmen, dass derjenige die Not besser kennt und die anstehenden Bedürfnisse angemessener zu befriedigen weiß, der ihr am nächsten ist und sich zum Nächsten der Notleidenden macht.“
Die beispielgebenden Grundrechte unseres Grundgesetzes verifizieren das Prinzip Subsidiarität, allerdings mit einer weittragenden Ausnahme. Die extensive, ja überbordende Auslegung des Begriffes "Aufsicht" in Art. 7 Abs. 1 GG verdrängt den ansonsten tragenden Grundsatz der Subsidiarität indem sie entgegen der Bürgerrechte das Schulmonopol des Staates fortsetzt.
Zur Klarstellung: Staaten sind die Garanten der freilassenden Lebensgestaltung ihrer Bürger. Unser Staat bewirkt dies durch das unverzichtbare Gewaltmonopol. Nur dadurch ist Demokratie überhaupt erst möglich; nur dadurch entwickeln Gesetze Rechtskraft und Durchsetzungsvermögen. Gilt gleiches auch für das Schulmonopol? Mitnichten! So wie das Gewaltmonopol die bürgerlichen Freiheits- und Gleichheitsrechte überhaupt erst zur Wirkung bringt, schränkt das Schulmonopol dieselben Rechte grundlos und ungebührlich ein. Wir drei haben dargelegt, dass dem so ist.
Der Staat handelt mit den von ihm als Monopolist betriebenen Schulen nicht subsidiär. Im Gegenteil: Er verwaltet es von oben herab in zentralistischer Manier. Damit gleicht seine Machart derjenigen der ehemaligen DDR, die musterhaft ja nicht nur Schulen sondern darüber hinaus die Wirtschaft verwaltet hat. Wie sich die Bilder gleichen. Sowohl die damalige Zentralverwaltungswirtschaft als auch die heutigen Zentralverwaltungsschule sind durch Eintönigkeit, Fremdbestimmung und Vielfaltslosigkeit geprägt.
Kein Bürger würde heutzutage nach unserer Einschätzung einem derart weltfernen Schulwesen zustimmen. Es widerspricht demokratischem Selbstverständnis. Es widerspricht ebenso der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeiten der Schüler*innen und dem natürlichen Recht der Eltern, ihre Kinder zu Pflegen und zu erziehen (Art. 1,2 und 6 GG).
Zudem negiert die Staatsaufsicht in ihrer überkommenen Form die Einsichten Ernst Friedrich Schumachers, dass Eigeninitiative, Flexibilität, Selbstverantwortung und Kooperation die Energie und den Motor nicht nur für die Wirtschaft sondern ebenso für die "Schulschaft" erzeugen.
Warum hat der Parlamentarische Rat im Grundgesetz den Subsidiaritätsgrundsatz in einem für unsere freiheitliche Zukunft derart wichtigen Gestaltungsbereich wie dem Schulwesen nicht einfließen lassen? Hochgebildeten Mitgliedern katholischen Glaubens musste der demokratie-inhärente Subsidiaritäts-Imperativ doch bekannt gewesen sein; unvereinbar mit einem staatlichen Schulmonopol. Sind sie bei ihrer hochzuschätzenden Absicht von den Kämpfern des althergebrachten Schulwesens überstimmt worden? Kam irgendwie eine Art faulen Kompromisses zustande? Oder trösteten sie sich durch ihre Blicke hin zu den Staaten-Nachbarn? Alle benetzen sich mit Staats-schulen. Sozusagen alle im selben Boot? Wie auch immer.
Schule gehört zu aller erst in die Hände von Eltern, ihren Kindern und Lehrern vor Ort; zu selbstverantwortlichem Organisieren und zum Betrieb - dies nach ihrer eigenen Vorstellung. Also in die Hände derer, die „die anstehenden Bedürfnisse angemessener zu befriedigen“ (Subsidiarität) wissen, als die orts- und realitätsferne staatliche Obrigkeit.
Der Beweis, dass Schulen in freier Trägerschaft gut gelingen, ist auch in der BRD längst erbracht. Verkennt der Staat nicht den riesigen wirtschaftlichen Aufwand sowie den verhältnismäßig schmalen Ertrag, den er mit seinem Schulunternehmen ins Werk setzt?
Der Staat behauptet nach wie vor die Unabdingbarkeit staatlichen Schulwesens durch das rechtlich nur ihm zustehende Berechtigungswesen. Nur so sei es ihm möglich, hoheitlich zertifizierte Bewertungen junger Menschen durch Noten, Zeugnisse und Abschlussprüfungen vorzunehmen und damit gestufte Zugangsqualifikationen für Weiterbildung oder Berufsausübung zu erteilen. Damit verkennt der Staat - wir wiederholen uns - ganz gravierende Nachteile. Status quo - Etikettierung bestimmter Leistungen negieren die Gesamtpersönlichkeit junger Menschen, sie beeinträchtigen zumeist ihr Selbstwertgefühl. Dies schadet unserem Gemeinwohl, denn solches erhöht ichbezogenes Konkurrenz- und Karrieredenken. (Eingehender oben in Brennpunkt 4)
Wie sehen Sie das alles? Genauso, ähnlich oder ganz anders? Wir beide und auch alle anderen sind mächtig neugierig.