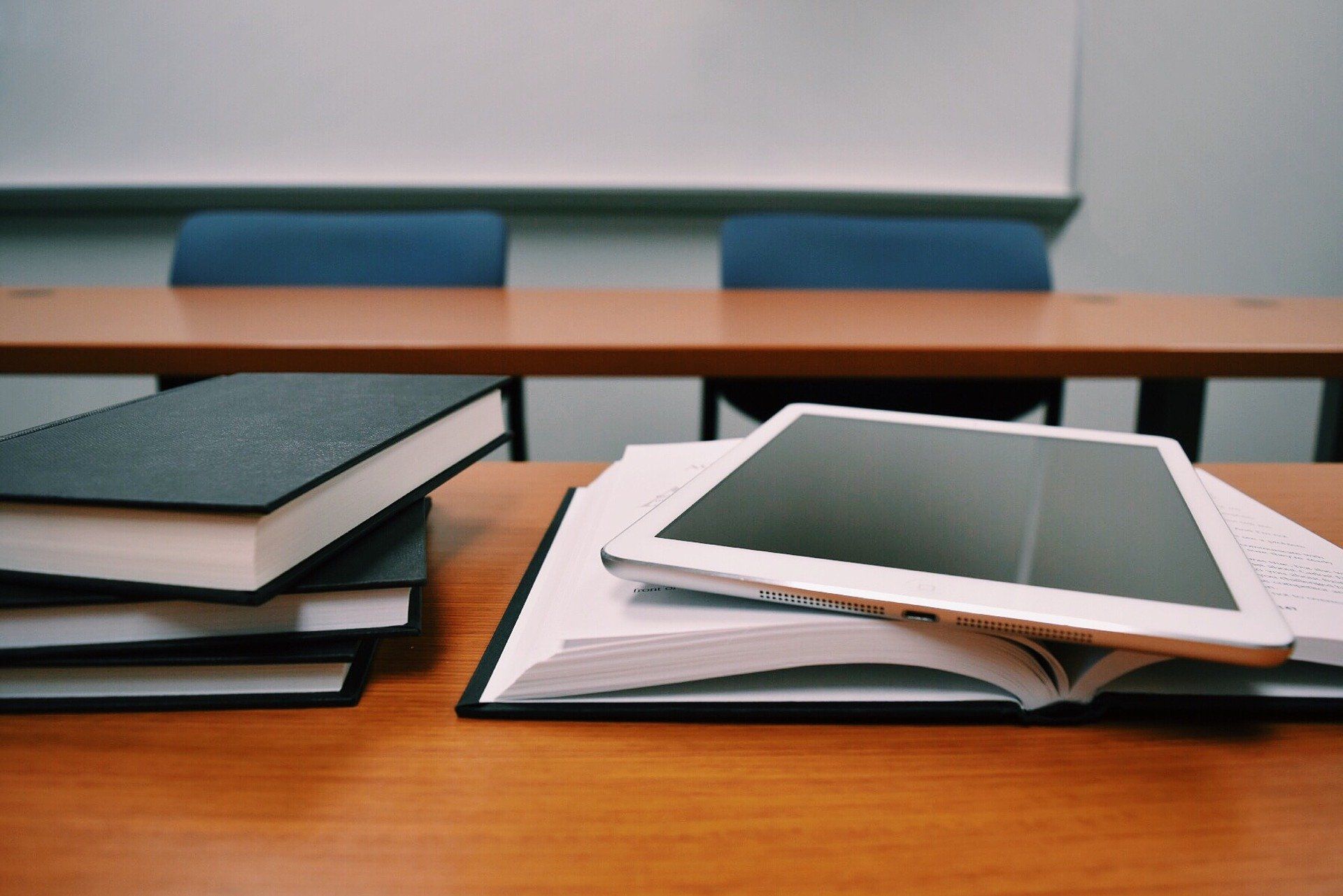Brennpunkt 5
Brennpunkt 5
Staatsaufsicht
"Wer anders denkt als seine Zeit,
muss nicht von gestern sein,
wer denkt, wie sie, ist es"
muss nicht von gestern sein,
wer denkt, wie sie, ist es"
Karlheinz Deschner
5.1 Geschichte
"Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart"
Richard von Weizsäcker
Warum Geschichte zuerst? Ganz einfach, wie sie bis heute ohne jegliche Logik die Staatsaufsicht des gesamten Schulwesens entscheidend prägt.
Kurz und knapp:
Der historische Urgrund unserer Staatsaufsicht ist aktuell leider immer noch prägend, so dass es sich lohnt, etwas tiefer einzutauchen. Klar wird dabei: Dem Volke, also uns allen, war und ist Mitgestaltung verwehrt. Aus blaublütigen Monarchen ist der Parteienstaat geworden. Auch dies mit ein Grund und Anlass, dass wir alle mittels einer Bürgerbewegung uns endlich Geltung verschaffen. Je mehr wir von der jüngsten Geschichte wissen, desto besser werden wir argumentieren. darum jetzt hinein in die Historie.
Als Antwort auf die Französische Revolution bestimmt König Friedrich Wilhelm II seinen Staat als Schulträger, dies mit der Pflicht, im Rahmen der Restauration die Landeskinder zu staatstreuen Bürgern zu erziehen. Die Kinder und Jugendlichen werden in Schulklassen fremdbestimmt, Menschenvielfalt wird negiert. Von da ab besitzt der Preußische Staat nicht nur das Hoheitsrecht über die Kasernen und Gefängnisse, sondern auch über die Schulen. Sein Sinn stehe nach "geschickteren und besseren Untertanen".
Geschickter und besser – das trifft es ganz gut. Denn tatsächlich geht der Bedarf in zwei Richtungen: Die neuen Verwaltungs-, Beamten- und Militärapparate erfordern eine Art Qualifizierungs- und Sortierungsmaschinerie, welche die im Nationalstaat benötigten Fachkräfte liefern kann: Offiziere, Bürokräfte, Verwaltungsfachkräfte. Der auf militärische und wirtschaftliche Expansion angelegte Nationalstaat braucht aber auch etwas Zweites, und zwar dringend eine nationale Identität, in der sich jeder Staatsbürger als Untertan im Dienst eines größeren Prinzips versteht. Anstelle von Kompetenz in der Agrarwirtschaft oder im hauswirtschaftlichen Milieu ist jetzt das gefragt, was einen effektiven Bürger eines totalitären Staates auszeichnet: Gehorsam, Unterordnung und Disziplin.
Da ist es also, das utilitaristische Bildungsprinzip – die Kinder sollen das liefern, was als brauchbar, als nützlich gilt. Allerdings, das 18. Jahrhundert würde seinem Ruf als „pädagogisches Jahrhundert“ nicht gerecht werden, wenn da nicht auch Gegenmeinungen formuliert worden wären. Tatsächlich ist bald die Diskussion um die richtige Bildung in vollem Gange. Da erinnert sich ein Wilhelm von Humboldt mit Verve an das emanzipatorische, zuerst von den Humanisten formulierte Ideal: Bildung solle dem Menschenhelfen, sich durch die Kraft des Geistes selbst zu bestimmen! Bildung solle deshalb nicht „im fremden Sinn“ (der Gesellschaft), sondern „im eigenen Sinn“ (des Individuums) passieren. Sie soll also auf das Menschlich-Allgemeine gerichtet sein, nicht auf das Gesellschaftlich-Funktionelle. Sie soll eine breite Grundlagenbildung schaffen und die kritische Benutzung des menschlichen Geistes fördern. „Wilhelm von Humboldt schreibt in seinem Buch „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ (1792), dass eine zu enge Verbindung zwischen Schule und Staat bestimmte Formen, Charakterhaltungen und Denkweisen begünstige, die die individuelle Entwicklung des Menschen behindern und damit letztendlich die Gemeinschaft und den Staat gefährden. Denn die Grundlage eines stabilen Gemeinwesens sei die größtmögliche Vielfalt von Meinungen und Interessen. Humboldts Einsatz endet allerdings nach nur 16 Monaten. Die vielen Scharmützel mit denen, die eher an einer Bildung „im fremden Sinn“ interessiert sind, haben ihn mürbe gemacht. „Es gibt nun einmal verschiedene Stände (…) in der menschlichen Gesellschaft“, so wird ihm von einem seiner Kritiker, dem Staatsrat Ludwig von Beckerdorff entgegengehalten, „sie sind rechtmäßig, sie sind unentbehrlich.“ In der preußischen Wirklichkeit läuft das Schulsystem erst recht nicht in die Humboldt´sche Richtung. Im praktischen Alltag steht der Drill auf dem Programm. Statt Nachdenken ist Nachsagen angesagt, statt geistiger Erleuchtung gab es Kopfnüsse. Und natürlich bleiben die Schüler*innen nach Ständen getrennt (Volksschule, Mittelschule und Gymnasium).
„Etwa um die gleiche Zeit legt der Schweizer Karl Victor von Bonstetten in seinen „Neuen Schriften“ (1799) dar, wie alles, was von der Regierung durch Ämter verwaltet werde, den Geist einschläfere und die öffentlichen Angelegenheiten dem Volk fremd werden lasse. Je aufgeklärter die Menschen werden, desto freier müsse auch ihr Bildungswesen werden. Der „Urtrieb im Menschen zur Freiheit“ sei es, der nach Entfaltung dränge und dem jegliche durch den Staat oktroyierte geistige Monokultur zuwiderlaufe.
Staatlicher Bürokratismus im Schulwesen – so von Bonstetten – neige von sich aus zu Konservatismus und Schwerfälligkeit, wo doch die moderne Schule mit dem Wandel der Zeit mitzugehen habe.
Knapp fünfzig Jahre später zieht Karl Mager in seiner „Pädagogischen Revue“ (1849) mit Vehemenz gegen eine geistlose und inkompetente Schulverwaltung zu Felde, die es sogar bis zur allgemeinen Demoralisierung der Bevölkerung treibe.
Kein Wunder, dass solche Praxis in den Ersten Weltkrieg mündet. Mit „Siegreich woll´n wir Frankreich schlagen“ stürmen die schulisch gut getrimmten Männer in die Schlacht.
Nach Ende dieses fürchterlichen Gemetzels findet Rudolf Steiner den zukunftsweisenden Ausweg durch die „Dreigliederung des sozialen Organismus“. Rudolf Steiner begründet, dass Freiheit nur in einem freien, zukunftsweisenden „Geistesleben“ gedeihen und dass unser „Wirtschaftsleben“ nur dann menschlich werden kann, wenn die Teilnehmenden brüderlich oder solidarisch handeln; erst mit beidem zusammen entsteht „Gleichheit im Rechtsleben“. Im Rahmen eines freien Geisteslebens wird dann auch die Freie Waldorfschule 1919 in Stuttgart gegründet. Nicht staatliche Zwecke sondern die jeweiligen Bedürfnisse und Anlagen der SchülerInnen, nicht Fremdbestimmung sondern Selbstentfaltung prägen die Schule.
Die damalige Reformschulbewegung zeigt, dass auch andere Weitsichtigen die Befreiung der Schule vom Staat einfordern. Maria Montessori ist nur das bekannteste Beispiel dafür. Für die damaligen Politiker und Vertreter der Weimarer Republik, selbstredend alles frühere Staatsschüler und in althergebrachtem, adaptivem Denken eingeübt, passt diese Innovative Bewegung nicht in ihr Weltbild.
Hochinteressant! Weimar als 1919 von Kaiserlich-preußischer Hoheit befreite Demokratie setzt hingegen besserwisserisch und daher gegen jede Vernunft die monarchische Hinterlassenschaft im schulischen Bereich mit all seinen demokratiefernen Merkmalen fort. Fällt den frisch gebackenen Abgeordneten nicht auf, wie wirkungsvoll die preußische Staatsschule den Boden für kriegerische "Heldentaten" düngt? Wie auch immer - jedenfalls müssen wir uns nicht wundern, dass die damaligen Kinder, weiterhin als Zöglinge in Staatsschulen "präpariert", für Hitler willkommenes "Futter" für seine obskure und mörderische Kriegslüsternheit werden. Trotz ihrer oft gymnasialen Schulbildung stimmen die Reichstagsabgeordneten 1933 Hitlers sogenanntes "Ermächtigungsgesetz" mehrheitlich zu und öffnen damit das Tor hin zur Diktatur Hitlers. Wie das, wo doch die Politiker von Hitlers "Mein Kampf" -seit 1927 verbreitet - wissen, was dieser nach unbeschränkter Macht Strebende alles vorhat? Nahezu zwangsläufige Folge ist dann das menschenverachtende, machtbesessene und mörderische Dritte Reich.
Im überfälligen Neubeginn einer Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung mit all seinen unmittelbar „geltenden“ Grundrechten bleibt dennoch Schule wie sie immer schon war: fremdbestimmt. Der Parteien-Staat sanktioniert trotz all der fürchterlichen jüngsten Erlebnisse das althergebrachte staatliche Schulwesen. „Postkutschenreparaturen“ werden als Reformen schöngeredet.
Kaum glaubhaft: Der Parlamentarische Rat fügt 1948/49 mitten in die beispielhaften Grundrechte des werdenden Grundgesetzes hinein als Art. 7 Abs. 1 den Schulaufsichtsbegriff des Art. 144 der Weimarer Verfassung. Auf diese Weise wird königlich-preußische Monarchie-Herrschaft zum basisdemokratischen Grundrecht gezaubert. Haben die Mitglieder des Parlamentarischen Rates all die Gräuel der allerjüngsten Vergangenheit bereits wieder vergessen? Dazu nur eine kurze Bemerkung des bekannten britischen Historikers Prof. Richard J. Evans anlässlich einer wohl fragwürdigen Mehrheitsentscheidung im britischen Unterhaus: "Die britischen Politiker hören nie auf die Historiker". Solches trifft in eher stärkerem Maße auf unsere deutschen Politiker zu. Dies zeigt überdeutlich unsere jüngste politische Entwicklung.
Natürlich verursacht das menschenferne staatliche Schulehalten die beiden fürchterlichen Weltkriege nicht alleine, es wirkt jedoch dorthin, und das genügt.
Überzeugt Sie das noch nicht so ganz oder sind Sie da ganz anderer Auffassung? Sollte dem so sein, dann liegt Ihnen vielleicht mehr an Grundsätzlichem zum Thema Schule.
5.2 Staatsaufsicht des Parteienstaates
"Erziehung ist wesentlich das Mittel,
die Ausnahme zu eliminieren zugunsten der Regel."
Friedrich Nietzsche
Unser Parteienstaat (-> Brennpunkt 2) verwaltet sich bürokratisch. Bürokratien gleichen Pyramiden mit einer Spitze und einer breiten Basis. In unserem Fall sitzt auf der Spitze der Kultusminister, der das Schulgesetz mithilfe der Ministerialbürokratie in Verordnungen, Erlasse und Richtlinien auffächert. Dieses Konvolut mit all seinen Ausführungsanweisungen, Zuständigkeiten, Zeitplänen und Berichtspflichten, Funktionen und Aufgabenvoluminas bestimmt, was alles die Staatsbeamten an der Basis, also die Lehrer*innen zu tun und zu lassen haben. Zwischen Kultusminister samt Ministerialbürokratie und den vielen Schulen vor Ort fungieren die Schulämter, als untere Schulaufsichtsbehörden.
Die Regelgebundenheit gewährleistet landeseinheitlich gewollte gleichförmige Arbeitsabläufe. Zugrunde liegt das Rechtsprinzip der Gleichheit. Da alle Schüler*innen gleichförmig zu behandeln und zu benoten sind, müssen sich die Lehrer*innen zur Zweckrationalität verpflichten. Amtsverpflichtung und eben weder Eigeninitiative noch persönliche Motive ist das Gebot allen Unterrichtens. Das Lehrmaterial muss kognitiver Natur und zudem quantifizierbar sein, damit Gedächtnisleistungen der Schüler*innen bewertet werden können. Disziplin und Ordnung sind die Wesensmerkmale allen Schulehaltens, wie es bereits in vordemokratischen kaiserlich-preußischen Zeiten als Bollwerk gegen die Französische Revolution konzipiert wurde.
Was hat dieses überkommene Konstrukt Staatsschule noch mit der Schule als Hort menschlicher Pädagogik und bürgerlicher Bildung zu tun? Vom Impetus her nichts!
Zudem:
Vorbestimmtes Lernen verdrängt das Recht zur freien Entfaltung der Kinderpersönlichkeiten, wie Art. 2 Abs. 1 unseres Grundgesetzes es gewährleistet. Gleichartigkeit jedoch ist das glatte Gegenteil von Vielfalt. Vielfalt ist das Ergebnis individueller Ressourcen, Lerntempis, Motivationen, Zielrichtungen und Eigenarten. Damit kann wahre Gleichheit nur Offenheit und eben nicht Vorgegebenes sein. Wer tatsächlich gegebene Vielfalt ernst nimmt, kann nicht junge Menschen oder junge Subjekte zu Objekten "degradieren", indem er ihre Leistungen bewertet, denn subjektive Leistungen lassen sich schlechterdings nicht bewertend vergleichen. Gerade weil erst praktizierte Vielfalt für uns alle grundlegend wichtig ist, um uns als Persönlichkeiten überhaupt entfalten zu können, steht uns das Vielfaltsgebot als Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 unseres Grundgesetzes zur Seite. Trotzdem negiert es die Staatsaufsicht.
Grundsatz aller Pädagogik ist menschliche Nähe zwischen Lehrer*innen und ihren Schüler*innen. All dies konterkariert der Vollzugsbeamte. Deshalb spüren viele Lehrer*innen, dass Pflicht und Neigung, also Amtspflichten und das Verwirklichen sinnhafter Pädagogik einem tagtäglichen Spagat gleichkommen. Ein wahrlich erforderlicher und anstrengender Spagat, wenn Lehrer*innen ernsthaft wollen, dass menschliches Miteinander die Schule wenigstens etwas belebt.
Trotz solchen meist aufreibendem Bemühen vieler Lehrer*innen gleicht Schule mehr einem Verwaltungsamt denn einem Hort, in dem Kinder untereinander mit ihren Lehrer*innen als anregenden Vorbildern in Projekten agieren, gemeinsam miteinander Erfahrungen sammeln und so Wissen verlebendigen.
Wir haben einen fundamentalen Rechtskonflikt!! Einem solchen zwischen einer Pädagogik, die das sich aus Art. 2 Abs. 1 GG ergebende Gebot zur Beachtung der Vielfalt der Schüler*innen würdigt und einem Staatsmonopol, dessen Wirkung das Unterrichten der Schüler*innen von oben vorgegeben ist, also wie "in fremdem Sinne" wirkt. Damit lässt der Parteienstaat das Vielfaltsgebot unberücksichtigt - er entmündigt.
Die Lösung
Für uns ist die Zeit reif, dass der Parteienstaat mit dem Prozess beginnt, den überfälligen Rechtskonflikt zu lösen. Damit rückt er zugleich "seinen" Staat ein beachtliches Stück der von vielen ersehnten Bürgerdemokratie näher. Solche politische Beweglichkeit hat bereits zwei Vorbilder, Chile und Schweden. In Schweden wurden nach dem Vorbild Chiles zum einen die Staatsschulen kommunalisiert, zum andern wurde das Finanzierungsprinzip Bildungsgutscheine für Schulkinder (siehe Brennpunkt 7) beschlossen; ab 2001 gleicher Betrag für alle Schulen, also auch die Bürgerschulen.
Warum kann der Parteienstaat nicht mal endlich die Goldkrone preußisch-kaiserlicher Schulhoheit ablegen, in dem er von der Überdehnung des Art. 7 Abs. 1 GG Abschied nimmt? Der Rechtsbegriff "Aufsicht" beinhaltet nämlich in aller Regel Rechtsaufsicht. Diese verbunden mit Dienst- und Fachaufsicht geht jedoch weit über bloße Rechtsaufsicht hinaus und bedeutet faktisch Träger- oder Unternehmerschaft. Was spräche dagegen, wenn der Parteienstaat seine extrem kostenaufwändige staatliche Veranstaltung kommunalisiert? Dabei steht ihm nach wie vor sein Grundrecht der Aufsicht über das gesamte Schulwesen zur Seite. Mit solcher Entscheidung erfüllt der Parteienstaat zudem den Willen vieler Eltern und Pädagogen, staatsfreie Schulen zu verwirkliche, natürlich verbunden mit dem Prinzip Bildungsgutschein nach schwedischem Vorbild (siehe Brennpunkt 7). Dieses Prinzip, verbunden mit der Kommunalisierung der staatlichen Unternehmerbürde erbringt darüber hinaus sogar eine Entlastung des Staatshaushaltes, denn der Posten Bildungsgutschein tritt an die Stelle der bisherigen stark belasteten Unternehmerbürokratie.
Ja, was halten Sie von unseren Bedenken? Haben Sie noch weitere Argumente? Wir freuen uns drauf.
5.3 Rechtsbruch
"In der kleinen Welt, in welcher Kinder leben, gibt s nichts,
dass so deutlich von Ihnen erkannt und gefühlt wird,
als Ungerechtigkeit."
Charles Dickens
Und jetzt kommt des Pudels Kern: 1957 gibt es einen Konflikt zwischen einer Kleinstadt und der staatlichen Schulaufsicht. Letztere verfügt, dass Schüler*innen nach elterlichem Willen aus "städtischen" Schulen in eine neu gegründete Katholische Konfessionsschule wechseln. Dagegen wehrt sich die Stadt aufgrund ihres grundgesetzlich normierten Selbstverwaltungsrechts nach Art. 28 Abs. 2 GG. Durch Urteil entscheidet das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) wie folgt:
"Der Begriff der staatlichen Schulaufsicht" in Art. 7 Abs. 1 GG ist "historisch auszulegen." Diese Auslegung billigt dem Staat als dem "alleinigen Schulherrn" das "ausschließliche administrative Bestimmungsrecht über die Schule" zu.
In den Folgejahren hält dieses Gericht an der Auslegung des Schulaufsichtsbegriffes fest. Selbst das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schließt sich dieser arbeitssparenden Sichtweise an, so dass diese zur herrschenden Rechtsauslegung mutiert.
Unbegreiflich, wie die höchstrichterlich Rechtsprechung ohne Wenn und Aber sich der historischen Auslegung des Art. 7 GG bedient, ohne den historischen Werdegang der staatlichen Schulaufsicht im Blick zu haben. Diese verfolgt nämlich damals dezidiert monarchisch hoheitlichen Impetus und passt überhaupt nicht in die heutige "freiheitlich demokratische Grundordnung" (GG). Helmut Fend weist in "Theorie der Schule" 1981 darauf hin, dass „am „Beispiel der Umgestaltung des Erziehungswesens im Dritten Reich … sehr deutlich studiert werden“ kann, wie „Bildungssysteme z. B. von politischen Instanzen ´in den Dienst ´ genommen werden, um ganz andere Ziele als die ´Bildung des Menschen´ zu erreichen“. Ohne Zögern spricht er von Missbrauch“ (1981, 13). Die nationalsozialistische Diktatur konnte das überkommene System ohne merklichen Widerstand für ihre ideologischen Zwecke instrumentalisieren. Kann man von einem System, das nachweislich missbraucht wurde, sagen, es habe sich bewährt“? Und heute lesen wir wiederum bei kompetenten Praktikern des Schulrechts und der Erziehungswissenschaft, Schulorganisation und Didaktik seien zur „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ geworden (Avenarius 1976: 25 und Grammes 1986: 16)
"Schulorganisation und Didaktik" als Mittel des heutigen Parteienstaats, die Heranwachsenden zu "geschickteren und besseren Untertanen" (1763, Generallandschulreglement) zu erziehen?
Das "besondere Gewaltverhältnis" lässt grüßen - immer noch!
Ist dies mit ein Grund dafür, dass die Scheinlegitimität der praktizierten Staatsaufsicht der tiefere Sinn des Parteienstaates ist und er des-halb kaum an einer eigentlich überfälligen Rechtsfortbildung interessiert ist?
Nimmt der Parteienstaat billigend in Kauf, dass viele Eltern mit ihren Kindern in hohem Maße nachteilsbetroffen sind, weil die praktizierte Staatsaufsicht zumindest mit den Artikeln 1, 2 und 6 unseres Grundgesetzes inkompatibel ist?
Fakt ist, dass Art. 7 Abs. 1 GG vom Hohen Gericht so hineininterpretiert wird, dass sein Inhalt zum "eigenständigen staatlichen Erziehungsrecht" (BVerfG 1975) passt, so wie es 1794 von Preußens König Wilhelm II konzipiert worden ist. Damit verwehrt uns der Parteienstaat als Eltern weiterhin die Mitgestaltung im Schulleben. Widersinnig, wo doch Schule ein Schwerpunkt des Sozialraumes unserer Kinder darstellt.
Die "Staatsfreiheit", BVerfG, als Verfassungsprinzip erklärt, bejaht die individuelle und öffentliche Meinungs- und Willensbildung" innerhalb unserer "freiheitlichen demokratischen Grundordnung" (GG). Und dieses Prinzip soll vor den Toren der Staatsaufsicht plötzlich halt machen?
Oben in 5.2 "Staatsaufsicht des Parteienstaates" schlagen wir dem Parteienstaat vor, den Bildungsgutschein "aus der Taufe zu heben". Er ist geeignetes Mittel zur Lösung des Rechtskonfliktes zwischen Vielfaltsgebot aus Art. 2 Abs. 1 GG und dem Monopol staatlichen Schulwesens. Warum soll, was dem Staate Schweden Recht ist, dem Parteienstaat nicht billig sein? Wir drei nennen es den sogenannten "Kleinen Wagen". Wenn dieser vom Parteienstaat nicht bewegt wird, dann bewegen wir, die Bürger den "Großen Wagen". Wenn der Parteienstaat es weiterhin zulässt, dass die Schulgesetze der Bundesländer auf irrtümlicher Auslegung des Art. 7 Abs. 1 GG fußen, also sich nicht um eine längst überfällige Rechtsfortbildung bemüht, dann ist es unser Wächteramt als Bürger und Mitträger der "freiheitlichen demokratischen Grundordnung" (GG), im grundlegenden Bereich von Erziehung und Bildung für Rechtsfrieden zu sorgen. Denn zumindest wir Eltern als unmittelbar Nachteilsbetroffene haben das Recht, unsere Kinder vom Besuch rechtsirrtümlich betriebener Schulen zu befreien, wenn diese in ihrer individuellen Entfaltung gem. Art. 2 Abs. 1 GG nachteilsbetroffen sind.
Wir sind nun mächtig gespannt, wie Sie diesen Brennpunkt sehen. Wenn Sie dies anders betrachten, so sind wir für Ihren Kommentar schon jetzt dankbar.